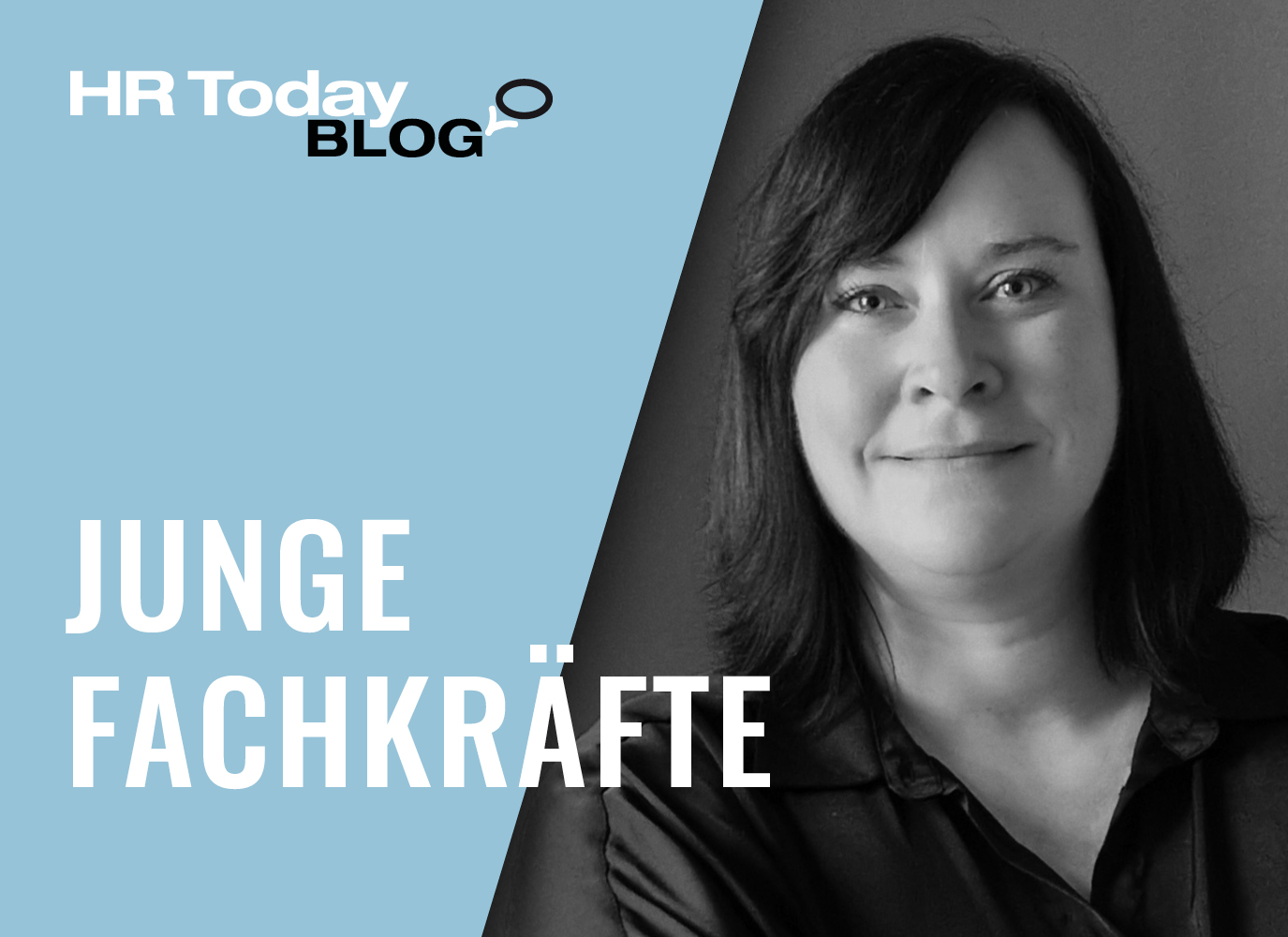Künstliche Intelligenz verändert die Art, wie HR arbeitet. Von der Bewerberauswahl bis zur Potenzialanalyse: datengetriebene Prozesse sind effizient, schnell und skalierbar. Doch der Erfolg hängt nicht nur von der Technologie ab, sondern davon, wie Menschen mit ihr umgehen. Besonders im Recruiting zeigt sich: Der Umgang mit KI ist längst zu einer Generationsfrage geworden.
Die Generationen
-
Gen Z – Offen & Fragen
Diese Generation wächst mit KI auf: Chatbots, automatisierte Termineinladungen und standardisierte Screeningfragen gehören für sie mit dazu. Sie leben im Zeitalter von digitaler Bewerbungserlebnisse, die mobil optimiert sind, intuitiv und transparent. Dies spiegelt sich darin wieder, dass 80 Prozent der Gen Z sich am liebsten via Smartphone bewirbt.
Aber: Nicht ganz ohne Fragen. Die Gen Z möchte wissen, wer die Entscheidungen trifft und wie das System im Hintergrund funktioniert. Wenn ein KI-System Bewerbungen vorsortiert, wollen sie wissen, nach welchen Kriterien. Ist ein Videointerview KI-basiert analysiert, erwarten sie eine klare Information. Nicht im Kleingedruckten, sondern offen und transparent als Teil des Prozesses.
-
Gen Y – Effizienzorientiert & verantwortungsbewusst
Generation Y stellt heute einen entscheidenden Teil der Arbeitskraft. Sie sehen die Vorteile der Automatisierung vor allem durch weniger manuelle Arbeit, schnellere Prozesse und besserer Skalierbarkeit. Besonders in der Vorauswahl, beim Matching und bei der Terminvergabe wird KI als praktischer und sinnvoller Hebel wahrgenommen.
Gleichzeitig kennt diese Generation die Verantwortung, die mit KI verbunden ist. Sie weiss, dass Algorithmen Vorurteile nicht ausschliessen, sondern oft verstärken. Die HR-Funktion wird daher nicht als «KI-Bedienung», sondern als Steuerungsinstanz verstanden. Für Gen Y steht fest: KI soll HR unterstützen, nicht ersetzen.
-
Gen X & Babyboomer – Erfahrungsstark & skeptisch
Wer seit Jahren in HR arbeitet, schätzt und kennt den persönlichen Austausch als zentralen Erfolgsfaktor. Vertrauen wird im Gespräch aufgebaut, nicht aufgrund KI-definierter Faktoren. Diese Generation greift auf langjährige Erfahrung in Auswahlgesprächen, Beurteilungen und Team-Dynamiken mit und begegnet KI mit Vorsicht.
Bedenken drehen sich nicht nur um Technik, sondern auch um Ethik und Verantwortung. Wer entscheidet, wenn es um eine Absage geht? Was passiert, wenn ein Algorithmus systematisch bestimmte Gruppen benachteiligt? Das Verlangen nach menschlicher Kontrolle steht klar im Vordergrund.
Was HR-Fachkräfte jetzt konkret tun können:
KI ist schon längst im Arbeitsalltag integriert, nun geht es darum, den Umgang damit zu definieren. HR muss dabei eine zentrale Rolle einnehmen, indem es die Perspektiven sowie Erfahrungen und Bedenken aller Generationen integriert und klare Prozesse und Strukturen schafft:
1. Einsatzbereiche definieren
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll. KI gezielt dort einsetzen, wo sie Prozesse objektiver und effizienter macht. Nicht aus Prinzip, sondern aus Bedarf.
2. Kompetenzen aufbauen
Nicht jede Generation startet mit denselben Voraussetzungen. Schulungen sollten diese Unterschiede aufgreifen und an den konkreten Aufgaben im HR-Alltag ansetzen.
3. Transparenz schaffen
Bewerbende, Mitarbeitende und HR-Teams müssen wissen, wann und wie KI im Spiel ist. Hinweise zu eingesetzten Tools, Info-Sessions oder verständliche Dokumentationen helfen, Wissen und Vertrauen zu stärken.
4. Verantwortung klar regeln
Wer entscheidet am Ende? Wo beginnt und endet die Verantwortung von HR? Klare Rollen helfen, Unsicherheiten abzubauen. Gerade wenn Maschinen mitentscheiden.
5. Datenschutz ernst nehmen
Gerade beim Einsatz von Hochrisiko-KI (beispielsweise in Auswahlprozessen oder bei Leistungsbewertungen) gelten hohe Anforderungen. Diese müssen nicht nur rechtlich, sondern auch kulturell abgestimmt und verankert sein.
6. Generationen einbinden
Erfahrung trifft Tech-Verständnis. Wer unterschiedliche Perspektiven im HR-Team zulässt, trifft bessere Entscheidungen und kann so KI-Systeme auf die Organisation abgestimmt einsetzen.
Welche rechtlichen Aspekte in der Schweiz zu berücksichtigen sind
Auch wenn der EU AI Act primär für den europäischen Raum gilt, betrifft sie indirekt auch Schweizer Unternehmen, insbesondere wenn sie:
- KI-Systeme in der EU anbieten oder einsetzen
- Mitarbeitende oder Bewerbende in der EU rekrutieren
- Softwarelösungen nutzen, die aus der EU stammen oder dort betrieben werden
In diesen Fällen greifen die Vorgaben des EU AI Act auch für Schweizer HR-Abteilungen. Das sogenannte Marktortprinzip macht es möglich: Entscheidend ist nicht, wo ein Anbieter seinen Sitz hat, sondern wo sein Produkt oder seine Dienstleistung auf den Markt gebracht wird.
Viele gängige HR-Tools, etwa zur automatisierten Bewerberauswahl oder Interviewanalyse, fallen unter die Kategorie Hochrisiko-KI. Ihr Einsatz ist erlaubt, aber an strenge Auflagen gebunden.
Zu den wichtigsten Pflichten zählen:
- Transparenzpflichten: Bewerbende müssen klar darüber informiert werden, dass eine KI mitwirkt
- Menschliche Aufsicht: Entscheidungen dürfen nicht allein durch KI-Systeme getroffen werden
- Organisationspflichten: Der Arbeitgeber muss sicherstellen, dass das System korrekt und regelkonform eingesetzt wird
- Auskunftspflichten: Auf Nachfrage müssen Bewerbende nachvollziehen können, wie eine Entscheidung zustande kam
Was das für Schweizer HR-Teams bedeutet:
Bereits heute lohnt es sich, bestehende Systeme zu prüfen, Prozesse zu dokumentieren und Mitarbeitende zu schulen. Wer grenzüberschreitend rekrutiert oder europäische Tools einsetzt, sollte spätestens jetzt aktiv werden.